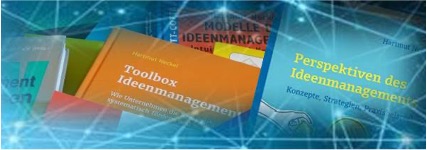In der Auswahl der ergänzenden Themen beim „Kennzahlenvergleich Ideenmanagement 2025“ fand die „Nutzung von KI im Ideenmanagement“ eine überwältigende Zustimmung. Demzufolge werden die Ergebnisberichte erstmals eine umfassende Bestandsaufnahme bieten, wofür und in welchem Umfang KI in der Praxis des Ideenmanagements tatsächlich eingesetzt wird. Und vielleicht noch spannender: Auswertungen, welche Anwendungen am stärksten mit Erfolgen im Ideenmanagement einhergehen. Doch gleichzeitig stellt sich auch die Frage, die ein Teilnehmer an der Abstimmung wie folgt formulierte: „Ich weiß aber nicht, ob ich über kurz oder lang überflüssig werde?“ Um diese Problematik geht es im folgenden Beitrag.
Von den Einsatzmöglichkeiten zum aktuellen Stand der Nutzung
Eine ganze Reihe von Blogbeiträgen hat sich bereits damit beschäftigt, wofür KI im Ideenmanagement genutzt werden könnte – sei es von Einreichern, von Bearbeitern, Gutachtern oder Entscheidern, oder von den Ideenmanagern selbst (siehe nachfolgende Liste). In den bisherigen Kennzahlenvergleichen war zwar mehrfach nach dem Einsatz von KI gefragt worden, jedoch war …
- … erstens der Anteil der Unternehmen, die überhaupt KI im Ideenmanagement nutzten, noch recht gering (im Kennzahlenvergleich 2024 zur „Motivation, Unterstützung, Entlastung von Gutachtern und Entscheidern“ 9%, im Kennzahlenvergleich 2023 als „in die Software zur Bearbeitung und Verwaltung von Ideen integrierte KI“ knapp 1%, im Kennzahlenvergleich 2022 für beliebige Anwendungen knapp 3%), und es war …
- … zweitens nicht gefragt worden, wofür dann KI im Einzelnen konkret genutzt wird.
Da sich am ersten Punkt im Zuge der raschen Verbreitung von KI-Anwendungen mittlerweile viel geändert haben dürfte, liegt es nah, nun den zweiten Punkt im nächsten Kennzahlenvergleich 2025 anzugehen. Dank der großen Datenbasis des Kennzahlenvergleichs Ideenmanagement kann dabei auch ausgewertet werden, welche Anwendungen die größte „Hebelwirkung“ für den Erfolg im Ideenmanagement erwarten lassen (siehe Blogbeitrag „Womit Erfolg im Ideenmanagement zusammenhängt“). Das erleichtert die Priorisierung von Ressourcen.
Bisherige Blogbeiträge zu Einsatzmöglichkeiten von KI im Ideenmanagement:
- Künstliche Intelligenz für das Ideenmanagement
- Was sagt eigentlich ChatGPT zum Ideenmanagement?
- Wo generative KI im Ideenmanagement helfen kann – und wo (noch) nicht
- Digitalisierung und KI im Ideenmanagement
- KI in der Praxis: Unterstützung für Einreicher als Add-on zur Software
- KI in der Praxis: Unterstützung für Einreicher durch modulare KI-Werkzeuge
- KI in der Praxis: User Journey mit Step-by-step Coaching durch Chatbot Avatare
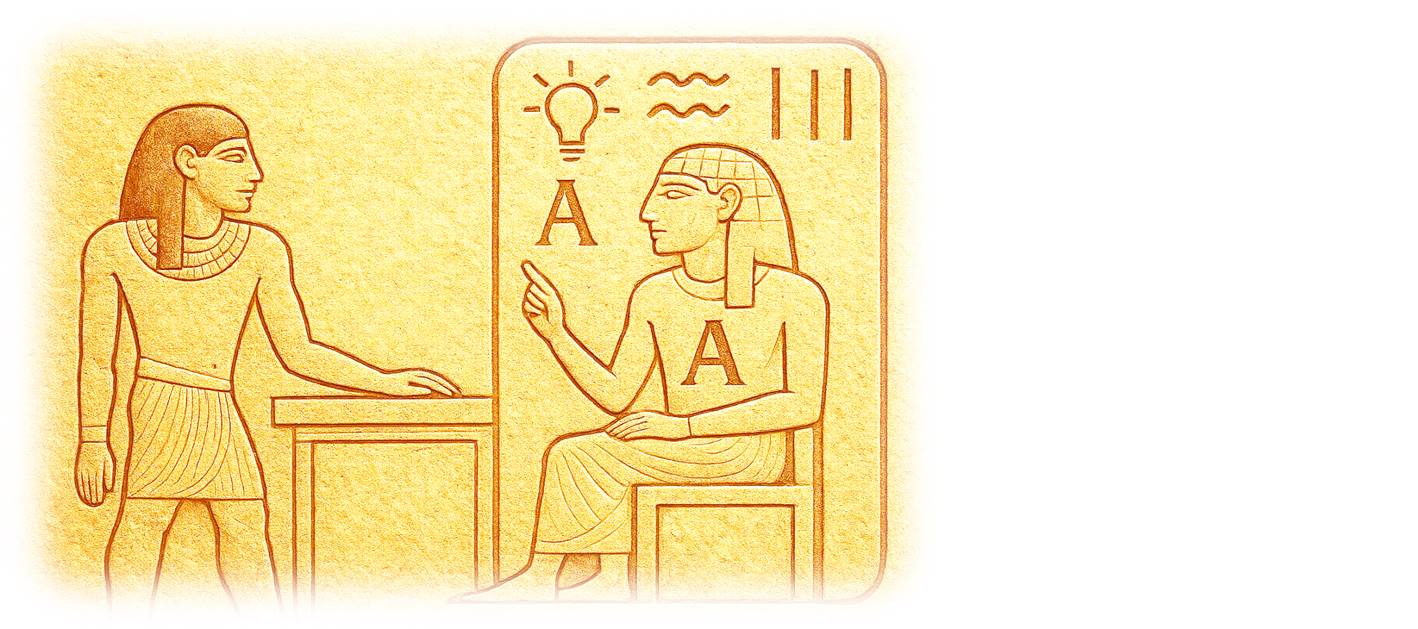
Was bedeutet KI für die Arbeit von Ideenmanagern?
Die Titelfrage dieses Blogbeitrags lässt sich variieren – was halten Sie von folgenden Formulierungen:
- Nimmt KI Ideenmanagern den Job weg?
- Nimmt KI Ideenmanagern Arbeit weg?
- Nimmt KI Ideenmanagern Arbeit ab?
Ich wage die These, dass Sie als Ideenmanagerin oder Ideenmanager bei einem „Ja“ auf die erste Variante KI nicht mögen würden, bei einem „Ja“ auf die dritte Variante dagegen durchaus.
In Diskussionen im Expertenkreis „Globales Ideenmanagement“ haben wir diesen Fragenkomplex mit einem ganz anderen Thema zusammengebracht: nämlich dem, ob und wie sich die Leistung von Ideenmanagern bewerten lässt. Beides führt zur Frage, was eigentlich Kern der Tätigkeit von Ideenmanagern ist bzw. im Idealfall sein sollte?
Ein erster Ansatzpunkt zur Leistungsbewertung können die erzielten Werte etwa für Beteiligungs-, Vorschlags-, Umsetzungs- und Einsparungsquoten, für Umsetzungsanteile und Durchlaufzeiten sein. Schließlich können Ideenmanager diese Kennzahlen durchaus beeinflussen, beispielsweise die Beteiligungsquote durch gezielte Kommunikations- und Motivationsmaßnahmen erhöhen, oder den Umsetzungsanteil durch strukturierte Prozesse oder Coaching verbessern (mehr solcher „Leistungsfelder“ sind weiter unten aufgelistet). Insofern tragen Ideenmanager eine Mitverantwortung für die Entwicklung der Kennzahlen.
Allerdings hängt der Erfolg noch von vielen anderen Personen und Parametern ab, auf die Ideenmanager nur geringen oder gar keinen Einfluss haben. Daher können sie nur begrenzt dafür verantwortlich gemacht werden, …
- … ob Mitarbeiter Ideen vorschlagen und wie gut diese Ideen sind und …
- … ob die dafür zuständigen Personen Vorschläge bearbeiten, begutachten, entscheiden, ggf. umsetzen und wie schnell und mit welcher Qualität sie das tun.
Deutlich mehr Einfluss auf das Verhalten von Mitarbeitern sowie Fach- und Führungskräften dürften die „maßgeblichen Personen“ des Unternehmens haben: also das Top-Management und die Regularien, die von ihnen durchgesetzt werden. Auch Faktoren wie Unternehmenskultur, Führung oder Ressourcen spielen eine Rolle, liegen aber eher außerhalb des Wirkungsbereichs von Ideenmanagern.
Die Kennzahlen müssen also um weitere Kriterien ergänzt werden, anhand derer bewertet werden kann, wie gut Ideenmanager „das Ihre“ für den Erfolg des Ideenmanagements tun, und wie die sich in Kennzahlen zeigenden Ergebnisse im jeweiligen Kontext interpretiert werden müssen. Dies setzt eine Klärung voraus, worin dieses „das Ihre“ besteht, was der „eigentliche Kern der Tätigkeit“ ist, für den Ideenmanager verantwortlich sind.
In der Praxis vieler Unternehmen sind die Ideenmanager den größten Teil ihrer Zeit mit operativen Tätigkeiten beschäftigt, die sich auf das Management der einzelnen Ideen beziehen. Für strategische Arbeiten am Ideenmanagement als solchem bleibt dann wenig übrig. Und genau hier kommen wir darauf zurück, welche Arbeiten KI abnehmen kann und sollte – und für welche anderen Arbeiten Ideenmanager auch zukünftig unverzichtbar bleiben werden. In der Kurzfassung lautet das Ergebnis:
- KI könnte die (operativen) Tätigkeiten beim „einzelne Vorschläge durch den Prozess Schieben und Begleiten“ weitgehend abnehmen. KI kann lernen, Routineaufgaben der Administration und Prozessabwicklung zu übernehmen.
- Strategische Tätigkeiten, bei denen es um Ambition und Verantwortung geht, können von KI unterstützt, aber nicht abgenommen werden. Dies sind gleichzeitig die Tätigkeiten, bei denen sich am ehesten die Leistung von Ideenmanagern (als Ergänzung zur Betrachtung von Kennzahlen) bewerten lässt.

Leistungsbewertung von Ideenmanagern
Im Folgenden sind wesentliche Leistungsfelder aufgelistet, die im Verantwortungsbereich von Ideenmanagern liegen und auf die sie direkt Einfluss nehmen können (etwa, um darüber wiederum positiv auf Kennzahlen einzuwirken):
- Strategie, Ziele
- Regelung des Prozesses und der Rollen
- Regelung der Prämierung, Honorierung, Incentivierung
- IT-Tool, Software
- Bekanntmachung, Marketing, Promotion, Kommunikation
- Befähigung, Learning Spaces
- Kampagnen
- Internationalität
- Controlling, Reporting
- Support, Beratung, Konfliktmanagement
- Change („dauerhafte Beeinflussung der Stakeholder“)
- Ideenmanagement-Community (innerhalb des eigenen Unternehmens)
- Beziehungen, Netzwerke (auch außerhalb des eigenen Unternehmens)
Während auf manchen Leistungsfeldern kontinuierliche Aktivitäten erforderlich sind (z.B. Marketing, Support, Beziehungs- und Community-Pflege usw.), müssen andere nur regelmäßig bearbeitet werden (z.B. Strategie und Ziele aktualisieren) und bei wieder anderen nur rechtzeitig Bedarfe für Weiterentwicklungen und Anpassungen erkannt und angegangen werden (z.B. Prozesse, Prämienregelungen, IT und Software, Routinen und Strukturen für Controlling und Reporting).
Die Leistungen von Ideenmanagern lassen sich nun danach bewerten, wie gut diese Leistungsfelder beackert und gegebenenfalls im Rahmen definierter Projekte vorangebracht werden:
- Bei Leistungsfeldern, die kontinuierliche und/oder regelmäßige Aktivitäten erfordern, lassen sich Kontinuität und Intensität bewerten.
- Bei Leistungsfeldern, die (nur) bedarfsweise Aktivitäten erfordern, lässt sich erstens bewerten, inwieweit Bedarfe rechtzeitig erkannt werden, und zweitens, was bei der Konzeption und Umsetzung entsprechender Projekte geleistet wurde.
- Bei allen Leistungsfeldern lässt sich bewerten, wie gut Anforderungen an Konformität und Stabilität einerseits sowie an Weiterentwicklung und Fortschritt andererseits vom Ideenmanagement erfüllt wurden.

Gedanken zum Unterschied zwischen KI und Ideenmagern
Sie mögen nun zu Recht einwenden, dass doch auch eine KI lernen könnte, die zuvor genannten Leistungsfelder zu beackern und Impulse zu ihrer Weiterentwicklung zu geben. Das führt auf ein Terrain, bei dem es gar nicht mehr um den Unterschied zwischen KI und Ideenmagern geht, sondern ganz grundsätzlich um den zwischen KI und Menschen. Ohne auf diesem Gebiet kompetent zu sein, bezieht sich meine persönliche Meinung dazu auf die Begriffe „Willen“, „Verantwortung“ und „Leiblichkeit“ (jedenfalls in diesem Kontext, generell kämen noch weitere hinzu):
- KI kann lernen, „Willen“ zu simulieren. Ob sie aber wirklich etwas (aus sich heraus) wollen kann, ob sie eigene Ambitionen entwickeln kann, bezweifle ich. Genau darauf kommt es aber bei den oben genannten Leistungsfeldern an: Hier geht es darum, Neugier und Antrieb zu entwickeln. KI kann zwar regelmäßige Impulse für potentiell „Wollens-wertes“ kreieren. Was davon aber tatsächlich gewollt ist, müssen stets Menschen entscheiden. Dabei kommt die Gefühls- und Trieb-Ausstattung des Menschen zum Tragen (der er zuweilen auch zu seinem Nachteil unterliegt, und die ihn von KI unterscheidet): Individuelle Vorlieben, Zu- und Abneigungen spielen eine Rolle und beeinflussen, mit wieviel Herzblut das Gewollte angegangen wird. (Als Veranschaulichung können Sie sich vorstellen, dass Sie an einem trüben Sonntag nicht recht wissen, wie Sie ihn verbringen wollen. Es kann hilfreich sein, sich dann von einer KI Vorschläge generieren zu lassen. Wohl kaum würden Sie aber der KI die Entscheidung überlassen, was Sie final tatsächlich tun. Was passieren könnte, wenn Sie die Kontrolle über Ihr Tun doch an KI abgäben, beschrieb George Cockcroft unter dem Pseudonym Luke Rhinehart in seinem Roman „Der Würfler“. Der Zufallsanteil in den Ergebnissen von generativer KI bewirkt nichts anderes als ein multidimensionaler Würfel.)
- Ob Menschen tatsächlich einen „freien Willen“ haben, ist eine alte Frage von Anthropologie, Philosophie und Religion. In der Praxis wird sie meist dahingehend beantwortet, dass wir Menschen zunächst für zurechnungsfähig und dementsprechend für ihr Verhalten verantwortlich halten. Ob man KI je dafür verantwortlich machen kann, was sie tut oder unterlässt, bezweifle ich. Die oben genannten Leistungsfelder des Ideenmanagements benötigen aber jemanden, der für sie, für ihren Zustand, Funktionalität und Weiterentwicklung Verantwortung übernimmt. (Die „Antwort“, die in Ver-antwort-ung steckt, ist eine, die ChatGPT & Co. Ihnen immer schuldig bleiben werden! Sie kennen vielleicht die Diskussionen um autonomes Fahren: Wenn eine KI am Steuer ist, wer wird dann in die Haftung genommen und bekommt die Punkte in Flensburg …? KI und Menschen haben gemeinsam, dass man sie bei Bedarf „nachschulen“ kann, aber Konzepte wie Lob und Tadel, Belohnung oder Bestrafung, Beförderung oder Entlassung auch auf KI anzuwenden, macht keinen Sinn.)
- Häufig wird als weiterer Unterschied aufgeführt, dass KI keine emotionale Verbindung zu Menschen aufbauen kann. Das mag stimmen – aber Menschen können eine emotionale Verbindung zu einer von ihnen gestylten KI aufbauen (und bekommen einen Blues, wenn sich ihre „Freundin“ oder ihr „Freund“ nach einem Software-Update an viele gemeinsame „Erlebnisse“ nicht mehr erinnert oder plötzlich fremde „Charakterzüge“ zeigt …). Bereits jetzt würden die wenigsten Menschen erkennen können, ob hinter einer „Person“, die sie nur online kennen, eine KI oder ein echter Mensch steckt. Und selbst, wenn KI stets als solche gekennzeichnet werden muss, könnte es immer mehr Menschen egal werden, ob sie mit einer KI oder mit einem echten Menschen online kommunizieren. Die Unterschiede werden jedoch wieder bedeutsam, wenn es um direkte persönliche Begegnungen, Kontakte und Beziehungen in der „echten“, „nicht-virtuellen“ Welt geht. Denn hier wird die Qualität des Erlebens dadurch bestimmt, dass soziales Verstehen und Empathie auf einem interaktiven, „zwischenleiblichen“ Prozess beruhen, in den die beteiligten Partner als „verkörperte“ („leibhaftige“) Wesen einbezogen sind. (Mehr zur Körperbezogenheit mentaler Prozesse finden Sie im Abschnitt „Das Gehirn als Körperorgan“ am Ende des Blogbeitrags „Neuroideenmanagement 2 – das Gehirn als Sozialorgan“.)
Als Fazit zitiere ich das Statement eines erfahrenen und sehr erfolgreichen Ideenmanagers: „Aus meiner Sicht ersetzt KI den Ideenmanager nicht, sondern entlastet ihn. Sie ist ein tolles Werkzeug zur administrativen Unterstützung, doch das Herz des Ideenmanagements – Kreativität, Kultur und menschliche Motivation – bleibt untrennbar in menschlicher Hand.“
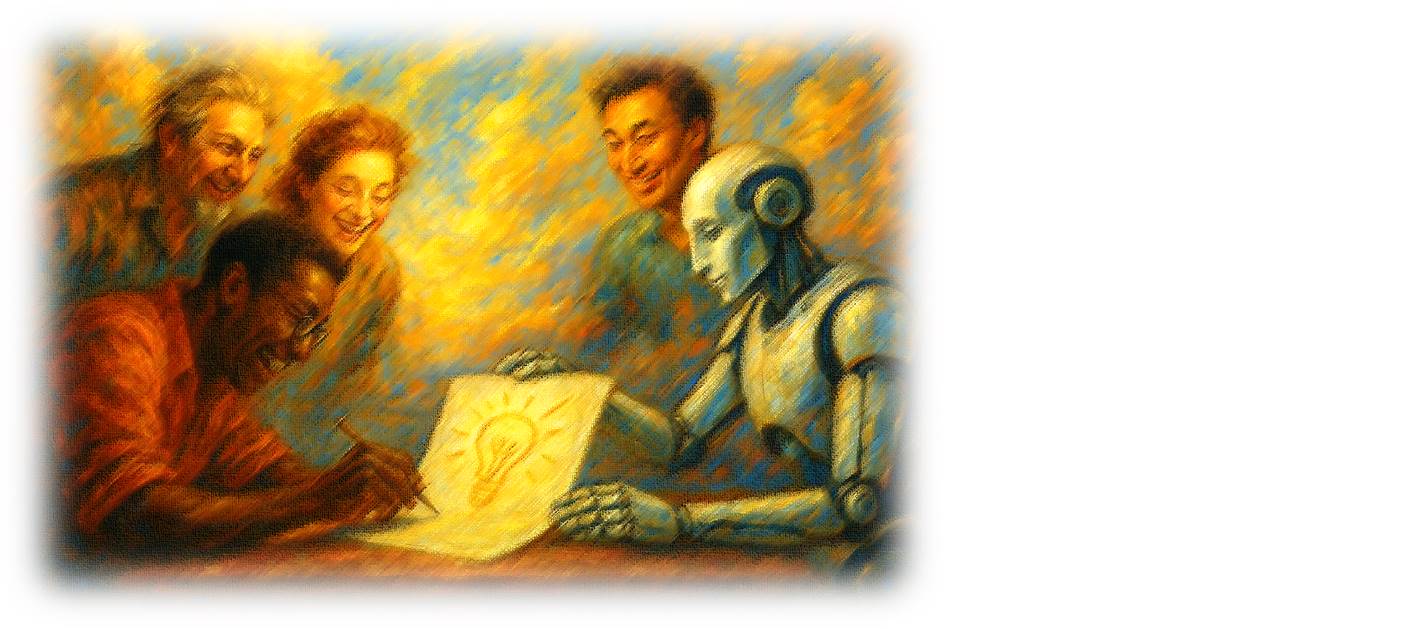
Nutzen Sie die Unterstützung durch KI, um sich auf Ihre Erfolgstreiber im Ideenmanagement konzentrieren zu können! Erfahren Sie als Teilnehmer am „Kennzahlenvergleich Ideenmanagement 2025“, wo KI die stärkste Hebelwirkung zeigt! Das Datenblatt steht ab Mitte November auf der Benchmarkseite zum Download bereit, die Datenerfassung läuft im ersten Quartal 2026.
Der Blog zum Ideenmanagement enthält übrigens zu fast allen Leistungsfeldern vielfältige Anregungen. Ein nach Stichworten sortiertes Verzeichnis mit Links auf alle bisher erschienenen Beiträge finden Sie in diesem Register.
Für die zahlreichen wertvollen Anregungen, die in diesen Blogbeitrag einflossen, bedanke ich mich sehr herzlich bei den Mitgliedern des Expertenkreises „Globales Ideenmanagement“!
Die Bilder wurden mit Image Creator in BING generiert.
Alle Erwähnungen von Unternehmen und Produkten sind redaktioneller Natur und wurden nicht bezahlt.

Dr. Hartmut Neckel
Dr. Hartmut Neckel ist einer der profiliertesten Vordenker und erfahrensten Praktiker im Themenbereich Ideenmanagement, Innovation und kontinuierliche Verbesserungsprozesse.